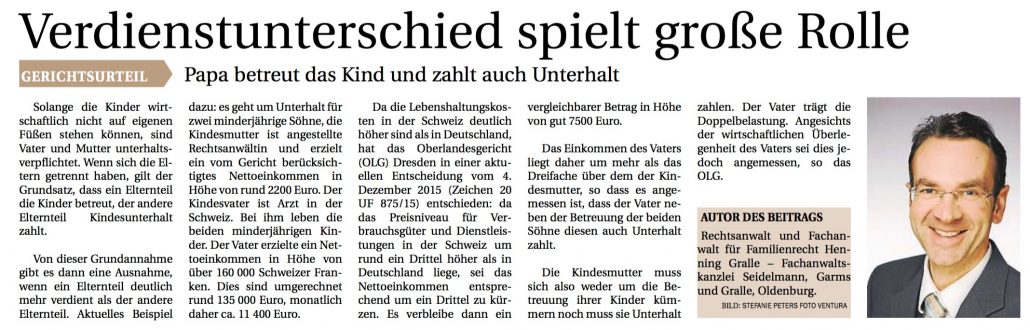Papa betreut das Kind und zahlt auch Unterhalt
Solange die Kinder wirtschaftlich nicht auf eigenen Füßen stehen können, sind Vater und Mutter unterhaltsverpflichtet. Wenn sich die Eltern getrennt haben, gilt der Grundsatz, dass ein Elternteil die Kinder betreut, der andere Elternteil Kindesunterhalt zahlt.
Von dieser Grundannahme gibt es dann eine Ausnahme, wenn ein Elternteil deutlich mehr verdient als der andere Elternteil. Aktuelles Beispiel dazu: es geht um Unterhalt für zwei minderjährige Söhne, die Kindesmutter ist angestellte Rechtsanwältin und erzielt ein vom Gericht berücksichtigtes Nettoeinkommen in Höhe von rund 2200 Euro. Der Kindesvater ist Arzt in der Schweiz. Bei ihm leben die beiden minderjährigen Kinder. Der Vater erzielte ein Nettoeinkommen in Höhe von über 160.000 Schweizer Franken. Dies sind umgerechnet rund 135.000 Euro, monatlich daher ca. 11.400 Euro.
Da die Lebenshaltungskosten in der Schweiz deutlich höher sind als in Deutschland hat das Oberlandesgericht (OLG) Dresden in einer aktuellen Entscheidung vom 4. Dezember 2015 (Zeichen 20 UF 875/15) entschieden: da das Preisniveau für Verbrauchsgüter und Dienstleistungen in der Schweiz um rund ein Drittel höher als in Deutschland liege, sei das Nettoeinkommen entsprechend um ein Drittel zu kürzen. Es verbleibe dann ein vergleichbarer Betrag in Höhe von gut 7500 Euro.
Das Einkommen des Vaters liegt daher um mehr als das dreifache über dem der Kindesmutter, so das es angemessen ist, dass der Vater neben der Betreuung der beiden Söhne diesen auch Unterhalt zahlt. Die Kindesmutter muss sich also weder um die Betreuung ihrer Kinder kümmern noch muss sie Unterhalt zahlt. Der Vater trägt die Doppelbelastung. Angesichts der wirtschaftlichen Überlegenheit des Vaters sei dies jedoch angemessen, so das OLG.
Autor: Rechtsanwalt und Fachanwalt für Familienrecht Henning Gralle – Fachanwaltskanzlei Seidelmann, Garms und Gralle, Alexanderstraße 111, Oldenburg. Tel. 0441/96 94 81 40 oder gralle@fachanwaelte-ol.de. Weitere Infos: www.fachanwaelte-ol.de